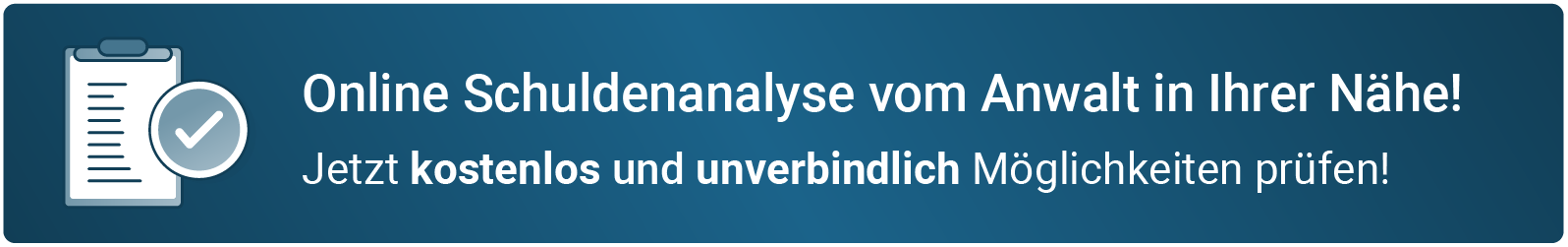Ihr Ansprechpartner bei Regelinsolvenz, Privatinsolvenz und Sanierung

Markus Balze
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Insolvenzrecht
Marienplatz 8
88212
Ravensburg
0751/1897055-0
Fax: 0751/1897055-10
Ihre anwaltliche Schuldnerberatung in Ravensburg
Herr Rechtsanwalt Markus Balze ist seit der Einführung der Insolvenzordnung am 01.01.1999 im Bereich der Unternehmenssanierung, Begleitung im Insolvenzverfahren und Regulierung von Privatverbindlichkeiten tätig. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehört:
- Verbraucherinsolvenzverfahren mit
- außergerichtliche Schuldenbereinigung
- gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahrens
- Regelinsolvenzverfahren von Kapitalgesellschaften und natürlichen Personen
- Vergleichsverfahren
- ESUG-Verfahren
- Pfändungsschutz
aber auch
- Insolvenzstrafrecht mit Sachverhalten aus den Delikten der
- Insolvenzverschleppung
- Bankrott
- Vorenthaltung und Veruntreuens von Arbeitsentgelt
- Betrug
Aufgrund dieser Schwerpunkte ergibt sich bei Selbstständigen sehr oft die Frage nach der Zukunft, insbesondere die Frage nach der Neugründung eines Unternehmens. Aus diesem Grund ergibt sich ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt von Herrn Rechtsanwalt Markus Balze, das Gesellschaftsrecht.
Außergerichtlicher Lösungsansatz
Im Rahmen der Tätigkeit als beratender Rechtsanwalt eines Schuldners wird Herr Rechtsanwalt Balze zunächst versuchen eine außergerichtliche Lösung mit den Gläubigern zu ermöglichen. Hierbei liegt sein Augenmerk auf einer möglichst schnellen vergleichsweisen Lösung der Probleme. Maßstab für den Lösungsansatz ist stets der mögliche Erlös für die Gläubiger im Insolvenzverfahren der dazu verwendet wird den Gläubigern entweder einen Ratenzahlungsvorschlag oder die Zahlung eines Einmalbetrages anzubieten, wobei das Angebot den Gläubiger nicht schlechter stellen darf als bei Durchlaufen eines Insolvenzverfahrens. Die Erfahrungen der letzten 19 Jahre haben gezeigt, dass häufig mit Einmalzahlungsvorschlägen eine Lösung der insolvenzrechtlichen Problematik erzielt werden können.
Hilfe für Kapitalgesellschaften in der Krise
Bevor es zu einem Insolvenzverfahren von Kapitalgesellschaften kommt besteht die Möglichkeit über eine Sanierung des Unternehmens die Probleme des Unternehmens zu lösen und den Betrieb wieder leistungs- und konkurrenzfähig zu machen. Hierzu werden von Herrn Rechtsanwalt Balze die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Probleme herausgearbeitet und zusammen mit den Unternehmern die Lösungsansätze erarbeitet. Im Rahmen der Sanierung wird versucht über eine möglichst frühzeitige Einschaltung der Gläubiger und Hausbanken eine Lösung der Unternehmenskrise zu finden.
Sollte eine Sanierung nicht mehr möglich sein, achtet Herr Rechtsanwalt Balze darauf, dass innerhalb der gesetzlichen Fristen Insolvenzantrag gestellt wird, damit es nicht zu strafrechtlichen Vorwürfen gegenüber dem Geschäftsführer/Unternehmer kommt. Nachdem mit einer Insolvenzantragstellung die Verfügungsbefugnis über das Unternehmen auf den Insolvenzverwalter übergeht, ist eine rechtzeitige Insolvenzantragstellung von besonderer Bedeutung, um zu verhindern, dass der Geschäftsführer vom Insolvenzverwalter über die Haftungsvorschriften des Gesellschaftsrechtes in Anspruch genommen wird.
Zugleich ist immer wieder festzustellen, dass Geschäftsführer ihren gesetzlichen Pflichten zur Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen nicht nachkommen, was nicht nur haftungsrechtliche sondern auch strafrechtliche Folgen hat. In diesem Zusammenhang wird durch Herrn Rechtsanwalt Balze auch eine Begleitung im Rahmen des Strafverfahrens angeboten um die Rechte des Mandanten im Rahmen dieser Verfahren wahrzunehmen.
Wir stehen Ihnen zur Seite
Im Rahmen der Betreuung in unserem Hause legen wir besonderen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. In Kenntnis der Bedeutung einer eingetretenen Zahlungsunfähigkeit oder einer Schieflage des Unternehmens versuchen wir im Interesse unserer Mandanten eine sinnvolle Lösung zu finden um das Leben wieder lebenswert zu machen.
Hinsichtlich des Insolvenzverfahrens, seines Ablaufs und der darin beinhalteten Möglichkeiten dürfen wir auf die von Herrn Rechtsanwalt Balze verfasste Kurzzusammenfassung über das Insolvenzverfahren, welches Sie nachfolgend finden, verweisen.
So finden Sie unsere Schuldnerberatung in Ravensburg
Ablauf eines Insolvenzverfahrens
Das seit 01.01.1999 eingeführte Verbraucherinsolvenzverfahren und dass gleichzeitig eingeführte Insolvenzverfahren für selbstständige natürliche Personen hat in den vergangenen 19 Jahren mehrfach Änderungen erfahren, im Kern ist es jedoch immer gleich geblieben. Nachfolgend ein kurzer Überblick über die wesentlichen Bestandteile des Verfahrens:
1.) Außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren bei Verbrauchern
Zunächst eine Definition: Verbraucher ist jede natürliche Person die Verbindlichkeiten aus Verträgen, Darlehen oder sonstigem hat. Ein ehemals Selbständiger kann auch ein Verbraucherinsolvenzverfahren durchführen, wenn seine Vermögensverhältnisse überschaubar sind. Dies ist dann der Fall, wenn der Schuldner weniger als 20 Gläubiger hat und keine Verbindlichkeiten als Arbeitsverhältnissen, also ehemaligen Mitarbeitern gegenüber hat. Im Vorfeld hat der Schuldner einen Versuch der außergerichtlichen Schuldenbereinigung mit seinen Gläubigern vorzunehmen. Dies kann alleine oder mithilfe geeigneter Personen oder Institutionen geschehen. Erst wenn dieser außergerichtliche Schuldenbereinigungsversuch gescheitert ist, kann der Schuldner innerhalb von 6 Monaten einen Insolvenzantrag stellen. Wartet er länger als 6 Monate, muss er den außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuch wiederholen. Im Rahmen des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens werden üblicherweise zunächst die Gläubiger angeschrieben, um die tatsächlichen Verbindlichkeiten zu ermitteln. Der Anspruch des Schuldners gegenüber dem Gläubiger auf Mitteilung der Verbindlichkeiten ist in § 305 InsO gesetzlich festgeschrieben. Aus den eingegangenen Forderungsmitteilungen der Gläubiger wird ein Gläubiger- und Forderungsverzeichnis erstellt und dann ein Schuldenbereinigungsplan an die Gläubiger versandt. Dieser kann die Zahlung eines monatlichen festen Betrages, die Zahlung des monatlich nach den gesetzlichen Bestimmungen festgelegten pfändbaren Anteils am Einkommen oder einen Einmalzahlungsbetrag an die Gläubiger vorsehen.
Damit eine Entschuldung in diesem Verfahrensstadium erreicht werden kann, müssen alle Gläubiger zustimmen. Dies geschieht natürlich nur dann, wenn der angebotene Vergleichsbetrag oder die angebotene monatliche Zahlung bei den Gläubigern zu einer weitestgehenden oder gänzlichen Rückführung der Verbindlichkeiten führt. Anzumerken bleibt, dass im Falle, dass ein Gläubiger während dieses Verfahrens Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegenüber dem Schuldner betreibt, der Schuldner einen außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan nicht mehr vorlegen muss, also das Verfahren abbrechen kann und sofort Insolvenzantrag stellen kann.
2.) Insolvenzantrag
Nach Durchführung des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens kann der Schuldner Einen Verbraucherinsolvenzantrag stellen. Nach Stellung des Insolvenzantrages prüft das Gericht zunächst einige Formalien, um dann die bisherigen Versuche des Schuldners zu prüfen. Im Falle eines durchgeführten außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens bei dem alle Gläubiger abgelehnt haben, da Ihnen der vergleichsweise angebotene Betrag zu gering war, wird das Gericht sofort das Insolvenzverfahren eröffnen, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Voraussetzung hierfür sind das Vorliegen der Zahlungsunfähigkeit, was meistens unproblematisch ist und im weiteren die Sicherung der bei Gericht anfallenden Verfahrenskosten. Entweder erbringt der Schuldner einen Kostenvorschuss, was meistens nicht ermöglicht werden kann oder er stellt einen Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten. Sofern der Schuldner die hierfür erforderlichen Formulare einreicht, wird das Insolvenzverfahrens öffnet.
Sollte sich bei Prüfung durch das Gericht herausstellen, dass bezüglich des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens mehrere Gläubigerrückantworten vorliegen, die im Rahmen des gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens eine Mehrheit darstellen würden bzw. die Chance auf eine Mehrheit durch Änderung der ablehnenden Haltung einzelner Gläubiger nach sich ziehen könnten, wird das Insolvenzeröffnungsverfahren für die Durchführung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens ausgesetzt.
3.) Gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren
Mit der Durchführung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens ergibt sich eine Möglichkeit für den Schuldner ein Insolvenzverfahren durch die Vorlage eines Planes zu umgehen. Das Gericht verschickt den gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan an die im Plan genannten Gläubiger mit der Aufforderung binnen eines Monats mitzuteilen, ob der Plan angenommen oder abgelehnt wird. Grundsätzlich gilt dabei, dass 3 Voraussetzungen vorliegen müssen, um zu einer Annahme des Plans zu kommen. Zunächst muss eine Kopfmehrheit der Gläubiger dem Plan zustimmen. Im weiteren muss diese Kopfmehrheit der zustimmenden Gläubiger auch eine Summenmehrheit haben. Im weiteren muss der Plan ersetzungsfähig sein. Dies bedeutet, der Plan darf die Gläubiger nicht schlechter stellen als sie bei Durchlaufen des Insolvenzverfahrens stehen würden; d.h., dass das Gericht bei der Prüfung dieser Frage zu klären hat, was die Gläubiger voraussichtlich im Rahmen eines Insolvenzverfahrens bekämen. Hinsichtlich bestehender Vermögensgegenstände, z.B. einer Lebensversicherung, ist dies noch einfach zu bestimmen, da dort der Rückkaufswert ermittelt werden kann.
Sonstige Vermögensgegenstände muss der Schuldner ebenfalls verwerten, sofern sie nach den allgemein gesetzlichen Bestimmungen pfändbar wären. Dies sind nicht die normale Wohnungseinrichtung oder z.B. ein Auto, das für die Fahrt zur Arbeit genutzt werden muss. Maßgeblich ist bei dieser Betrachtung dasjenige, was der Schuldner im Rahmen eines Insolvenzverfahrens aus seinem Einkommen dem Treuhänder und damit der Masse zur Verfügung stellen muss. Dies ist zumindest das, was auf die entsprechende Dauer eines gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens den Gläubigern angeboten werden muss. Sofern der Schuldner einen Einmalzahlungsbetrag anbieten möchte, der ihm ja von 3. Seite zur Verfügung gestellt werden kann, muss dieser natürlich wertmäßig den pfändbaren Anteilen am Einkommen entsprechen. Eine besondere gesetzliche Regelung ist in diesem Verfahrensabschnitt noch zu erwähnen. Nachdem die Gläubiger eine Aufforderung zur Stellungnahme binnen einer Frist von einem Monat erhalten haben, gilt für den Fall, dass sich ein Gläubiger nicht zurückmeldet, dass dessen Schweigen als Zustimmung zu werten ist, sodass z.B. bei 7 Gläubigern 6 schweigende Gläubiger den einzigen ablehnenden Gläubiger überstimmen können.
Besonderes Augenmerk muss in diesem Verfahrensabschnitt auf die Benennung aller Gläubiger gelegt werden, da der gerichtliche Schuldenbereinigungsplan nur mit denjenigen Gläubiger zu Stande kommt, die im Plan genannt sind. Sofern ein Gläubiger „vergessen„ wird, nimmt er nicht am Plan teil und ist danach noch zu bezahlen. Scheitert das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren wird das Insolvenzeröffnungsverfahren wieder aufgenommen und das Insolvenzverfahren sofort eröffnet.
4.) Insolvenzverfahren
Nachdem der Schuldner mit der Stellung des Insolvenzantrages eine Übersicht über sein Vermögen und eine Aufstellung der Gläubiger eingereicht hat, werden die Gläubiger durch den Insolvenzverwalter angeschrieben und aufgefordert ihre genauen Forderungen mitzuteilen. Gleichzeitig wird die Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Internet öffentlich bekannt gemacht, sodass ein Gläubiger, den der Schuldner vielleicht „vergessen" hat, ebenfalls von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens Kenntnis bekommt und aufgefordert ist seine Forderung mitzuteilen. Dies ist wichtig um sicherzustellen, dass alle Gläubiger am Verfahren beteiligt werden bzw. die Chance auf Beteiligung haben. Für den Fall, dass Vermögensgegenstände vorhanden sind, wie z.B. Lebensversicherungen, wird der Insolvenzverwalter diese verwerten.
Gleichzeitig wird er den Arbeitgeber des Schuldners anschreiben und sich die pfändbaren Anteile am Einkommen auf ein Anderkonto in seinem Haus überweisen lassen. Von diesen eingehenden pfändbaren Anteilen am Einkommen werden zunächst die Kosten des Gerichtes und des Insolvenzverwalters bezahlt. Danach wird an die Gläubiger ausgeschüttet. Dass in einem Insolvenzverfahren gar keine pfändbaren Anteile am Einkommen anfallen, ist ebenfalls denkbar. Der Schuldner stellt mit Einreichung des Insolvenzantrages gleichzeitig einen Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten. Diese werden ihm bis zur Erteilung der Restschuldbefreiung gestundet. Denkbar ist also, dass ein Familienvater mit 4 Kindern keinen pfändbaren Anteil am Einkommen hat. Die Verfahrenskosten werden im gestundet. Nach Erteilung der Restschuldbefreiung für jeden möglichen denkbaren Betrag, seien es 1.000 € oder 1 Mio. €, wird der Schuldner nach der Erteilung der Restschuldbefreiung von der Landesoberkasse angeschrieben werden und zur Bezahlung der Kosten in Höhe von 1.500 € bis 2.000 € aufgefordert. Diese kann der Schuldner dann in Raten zahlen. Er erhält somit Restschuldbefreiung vor Zahlung der Verfahrenskosten.
Der Schuldner hat während des Insolvenzverfahrens Verpflichtungen, die er gegenüber dem Insolvenzverwalter zu erfüllen hat. Diese sind in § 295 InsO geregelt. Der Schuldner hat vordringlich eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben und die daraus resultierenden pfändbaren Anteile am Einkommen an den Insolvenzverwalter abzugeben. Im weiteren hat der Schuldner Erbschaften, die er während des Insolvenzverfahrens macht, zu 100 % an den Insolvenzverwalter herauszugeben. Arbeitsplatz- und Wohnungswechsel hat er dem Insolvenzverwalter ebenso mitzuteilen, wie er auch gegenüber dem Insolvenzverwalter zu umfassenden Auskünften verpflichtet ist.
Sofern der Schuldner kein abhängiges Beschäftigungsverhältnis finden kann oder lieber selbständig ist, gewährt ihm die Insolvenzordnung diese Möglichkeit. Der Schuldner ist in Ausübung einer selbständigen Tätigkeit verpflichtet an den Insolvenzverwalter Zahlungen zu leisten, wie der Schuldner sie Im Rahmen einer angemessenen abhängigen Erwerbstätigkeit hätte leisten müssen. Der Schuldner muss gemäß § 295 Abs. 2 InsO die Gläubiger also so stellen, als ob er ein abhängiges angemessenes Beschäftigungsverhältnis angenommen hätte. Diese Regelung hat den Sinn darin, dass der Schuldner sich nicht durch eine Flucht in die Selbstständigkeit arm machen kann, indem er als Selbstständiger etwa im Rahmen der ihm zustehenden unternehmerischen Entscheidungen seinen Gewinn durch Anschaffungen oder Beschäftigung von Familienangehörigen vermindern oder gänzlich gen Null reduzieren kann. Die Verpflichtung gemäß § 295 Abs. 2 Insolvenzordnung hat aber auch das Problem, dass ein erfolgreicher selbstständiger Schuldner nur dasjenige abgeben muss, was er aus abhängiger Beschäftigung erzielen würde. Die Bestimmung ist daher häufig kritisiert worden, bis heute jedoch vom Gesetzgeber nicht geändert worden.
Anzumerken bleibt in diesem Zusammenhang, dass auch im Insolvenzverfahren ein Vergleichsvorschlag an die Gläubiger gemacht werden kann. Ein derartiger Plan nennt sich dann Insolvenzplan und kann eine Abweichung von den gesetzlichen Bestimmungen der Entschuldung vorsehen. Dies kann durch eine Einmalzahlung oder durch eine schnellere Zahlung geschehen und damit eine Verkürzung des gesamten Verfahrens bewirken. Während in einem Verbraucherinsolvenzverfahren das außergerichtliche und gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren dem Schuldner als Alternative zur Verfügung stehen, steht dem selbstständigen Schuldner oder dem ehemals selbstständigen Schuldner mit einer Gläubiger Anzahl von über 19 Gläubigern oder Verbindlichkeiten aus Arbeitsverhältnissen, nur die Möglichkeit dieses Insolvenzplanverfahrens zur Verfügung. Im Vergleich zum Verbraucherinsolvenzverfahren muss der Selbstständige also die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und die damit einhergehende Eintragung in der SCHUFA hinnehmen um einen Vergleich mit seinen Gläubigern erzwingen zu können.
Nach Anmeldung der Forderungen durch die Gläubiger beim Insolvenzverwalter findet ein Berichtstermin statt, in dem der Insolvenzverwalter über den Schuldner berichtet. Erfahrungsgemäß trifft man dort keinen Gläubiger an. Es wird dann das Verfahren abgeschlossen. Je nach Gericht und Insolvenzverwalter dauert ein Insolvenzverfahren zwischen 6 Monaten und 18 Monaten. Nach Ablauf dieses Insolvenzverfahrens beginnt die sog. Wohlverhaltensphase.
5.) Wohlverhaltensphase
Nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens beginnt die Wohlverhaltensphase. Hier gilt der § 295 InsO weiter, allerdings mit der Besonderheit, dass Erbschaften nur zur Hälfte herauszugeben sind. Während dieser Zeit werden die pfändbaren Anteile vom Treuhänder weiter eingezogen oder der Schuldner hat im Rahmen seiner Selbstständigkeit die freiwilligen Zahlungen zu leisten. Hinsichtlich der Laufzeit der Wohlverhaltensphase ergeben sich seit dem 01.07.2014 unterschiedliche Möglichkeiten. Grundsätzlich dauert das Insolvenzverfahren und die Wohlverhaltensphase nach den gesetzlichen Bestimmungen 72 Monate.
Sofern durch die pfändbaren Anteile am Einkommen oder einen Wertgegenstand, wie eine Lebensversicherung, die Kosten des Insolvenzverfahrens und der Wohlverhaltensphase bezahlt sind, reduziert sich die Dauer des gesamten Verfahrens auf 60 Monate. Im Falle, dass der Schuldner während der Laufzeit des Verfahrens binnen 36 Monate 35 % der Gläubigerforderungen beglichen hat, reduziert sich das Verfahren auf eben 36 Monate. Die Reduzierung des Verfahrens auf 60 Monate dürfte sich durchsetzen. Eine weitere Verkürzung auf 36 Monate wird es wohl nur in Ausnahmefällen geben.
6.) Restschuldbefreiungsverfahren
Nach Ablauf der Wohlverhaltensphase werden die Gläubiger aufgefordert zum Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung Stellung zu nehmen und eventuelle Versagensanträge zu stellen. Nach Anhörung der Gläubiger wird durch das Gericht die Restschuldbefreiung ausgesprochen. Für die Dauer von einem Jahr gibt es eine Nachfrist, in der die Gläubiger beantragen können, die Erteilung der Restschuldbefreiung zu widerrufen, wenn Sachverhalte offenbar werden, die eine Versagung rechtfertigen könnten. Die Versagung der Restschuldbefreiung wird zumeist auf einen Verstoß gegen die Mitwirkungspflichten oder die Verpflichtung zur Abführung von Beträgen gestützt. Auch bestimmte Verurteilungen in Strafverfahren aufgrund von Insolvenzstraftaten können zu einer Versagung der Restschuldbefreiung führen.
Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang noch darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber schon bei der Einführung des Insolvenzverfahrens für Verbraucher Regelungen in die Insolvenzordnung aufgenommen hat, die die Interessen von Gläubigern schützen. So sind Forderungen aus unerlaubten Handlungen, also Straftaten, wie Betrug und Untreue etc., auf Antrag des Gläubigers von der Restschuldbefreiung ausgenommen. Auch Unterhaltspflichtverletzungen gegenüber Kindern werden auf Antrag von der Restschuldbefreiung ausgenommen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Entschuldungsmöglichkeiten nach der Insolvenzordnung, trotz der widerstreitenden Interessen der Schuldner und der Gläubiger, den Menschen wieder Lebensperspektiven verschaffen können.
Die Rechte der Gläubiger sind dabei nach Auffassung des Unterzeichners sicherlich ausreichend berücksichtigt. Sofern Gläubiger bemängeln, dass zu viele Restschuldbefreiungserteilungen vorgenommen werden, muss festgehalten werden, dass die Gläubiger sich in Insolvenzverfahren um ihre Rechte nicht kümmern und insofern die Erteilung von Restschuldbefreiungen insbesondere aufgrund der Untätigkeit der Gläubiger zu Stande kommen.